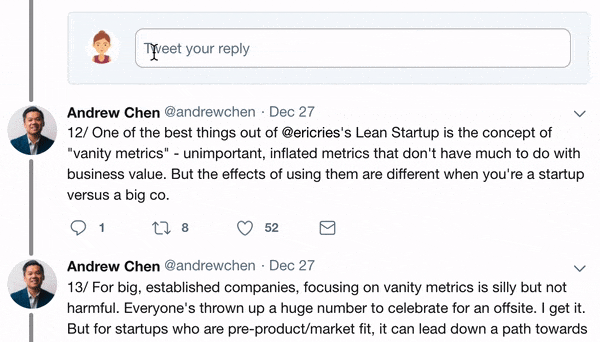Anlässlich der wieder aufkommenden Diskussionen zum #Hackback etwas Geschichte und warum offensive Cyberfähigkeiten und das Problem dahinter gar nicht mal so einfach ist – aber #Hackback auch keine einfache Lösung: 🧵
rnd.de/politik/abwehr…
rnd.de/politik/abwehr…
Vorne weg: Es gibt fundiertere Expert*innen zu dem Thema, z. B. den guten @HonkHase von der @AG_KRITIS ag.kritis.info/2022/03/23/wir…
Kommen wir aber zum geschichtlichen Exkurs in 19. Jahrhundert und möglichen Parallelen im Problemfeld und dem eigentlichen Verständnis damit – und was das mit den heutigen Problemen zu tun hat:
Krieg im 18. Jahrhundert war eigentlich klar definiert. Stark simplifiziert betrachtet trafen sich da zwei oder mehr Heere auf einem Schlachtfeld. Beispiel Austerlitz 1805: Frankreich gegen Östereich / Russland.
de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_…
de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_…
Die einen mit blauen Uniformen, die anderen rot. Klare Abgrenzung und Attribution des Feindes. Am Ende gewinnt eine Seite. Bei Austerlitz Napoleons französische Armee.
(Gemeinfrei, commons.wikimedia.org/w/index.php?cu…)
(Gemeinfrei, commons.wikimedia.org/w/index.php?cu…)

Nächster Krieg im 19. Jhd: Napoleonische Kriege auf der Iberischen Halbinsel oder spanischer Unabhängigkeitskrieg. 1808 bis 1814. Kurzzusammenfassung: Ging diesmal ziemlich schlecht für Napoleon aus.
de.wikipedia.org/wiki/Napoleoni…
de.wikipedia.org/wiki/Napoleoni…
Das Besondere an diesem Krieg war das Auftreten eines Elements der Kriegsführung: Guerilla - "kleiner Krieg".
Hier änderte sich das Feindbild, was es vorher gab.
Der Feind hatte keine klar erkennbaren Uniformen mehr. Tritt nicht mehr in klaren Truppenformationen auf.
Hier änderte sich das Feindbild, was es vorher gab.
Der Feind hatte keine klar erkennbaren Uniformen mehr. Tritt nicht mehr in klaren Truppenformationen auf.
Er war nicht mehr fein säuberlich auf einem Schlachtfeld versammelt, sondern quasi überall. Angriffe auf dem Hinterhalt in Kleingruppen, Angriffe aus Teilen der Bevölkerung, von Mönchen (!) und sonstigen Beteiligten.
(Public Domain commons.wikimedia.org/w/index.php?cu…)
(Public Domain commons.wikimedia.org/w/index.php?cu…)

"Wherever we arrived, they disappeared, whenever we left, they arrived — they were everywhere and nowhere, they had no tangible center which could be attacked."
Zitat aus dem Buch "Guerrilla Warfare" – Talbott, John (1978)
Zitat aus dem Buch "Guerrilla Warfare" – Talbott, John (1978)
Am Ende wurde es für Napoleon ein Krieg, den er nicht gewinnen konnte – vor allem auch, weil nicht mal klar war, wo eigentlich der Feind genau war, der besiegt werden sollte. Im Zweifel war er überall und nirgendwo.
Harter Cut in die Welt des Cyber: In gewisser Weise befinden wir uns jetzt wieder in einer gleichen Situation. Wir fürchten Angriffe im Cyberraum, versuchen Mittel zu definieren, die wir nutzen, um zurückzuschlagen – #Hackback.
Wir haben aber das gleiche Problem wie Napoleon mit partida de guerrilla. Cyberangriffe sind schwer vorherzusagen, sie sind überall und nirgendwo, so ein wirkliches klar definierbares Zentrum, das zurückgehackt werden kann, gibt es auch nicht.
War es wirklich $Staat, der da hackte? War es nur eine Sympathisanten-Gruppierung? Script-Kiddies? Oder eine False-Flag-Aktion? Im Cyber ist das sogar noch komplizierter geworden als mit Guerilla in persona.
In dem Dunstkreis #Hackback wird dann aber auch immer von "staatlichem Schwachstellenmanagement zur Gefahrenabwehr" fabuliert.
Schwachstellen kennen aber keine Nation, der sie gehorchen, sie sind erst mal für alle da, die sie ausnutzen können. Sei es in Hardware oder Software.
Jede strategisch zurückgehaltene Schwachstelle wird also unter Umständen zur eigenen Schwachstelle. Das ist eine weitere Dimension, die bei #Hackback gerne hinten runter fällt.
Abwehr von Cyberangriffen ist wichtig und durchaus einfach umsetzbar. Ja, gerne mehr davon. Offensive Cyberfähigkeiten allerdings sind hochkomplex. Ne, so nicht.
Es wirkt aber irgendwie so, als würde man auf einen Angriff "aus dem Internet" damit reagieren wollen, das "Internet zu attackieren", weil recht viel genauer an die Angreifenden kommt man oftmals nicht heran.
In einem gigantischen Komplex von Computern muss man aber immer aufpassen, am Ende nicht sich selbst zu treffen.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh