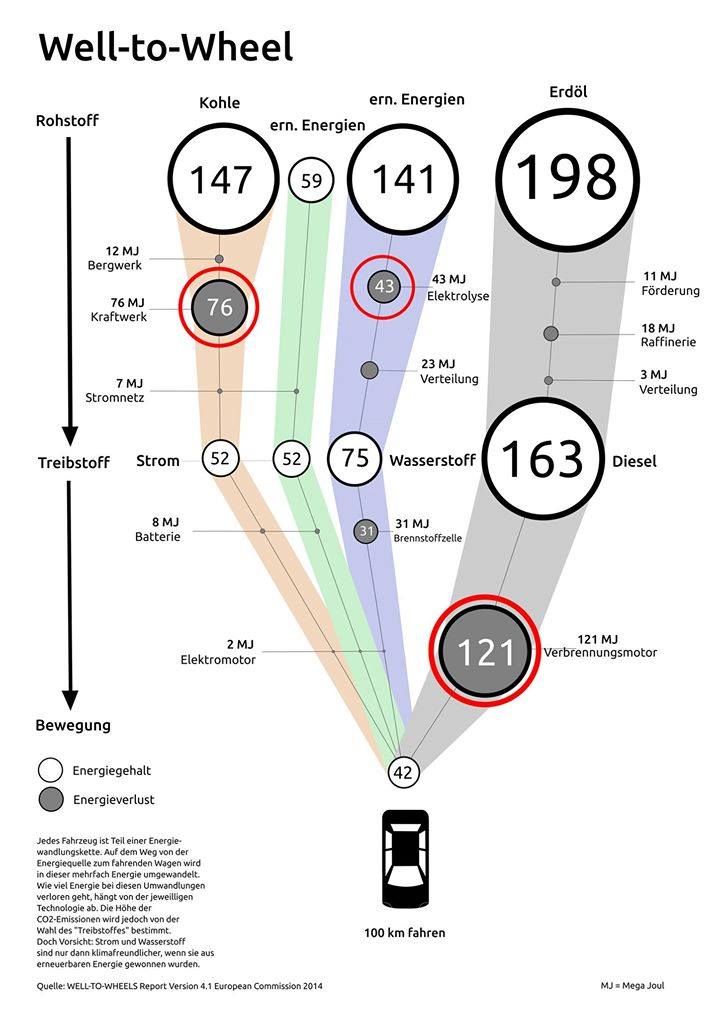😘 Beantwortet bitte die Umfrage vor dem Lesen des gesamten Threads. Am Ende findet ihr eine weitere identische.
Ich bin gespannt und hoffe 7 Tage reichen für eine Stichprobe und Feedback eurerseits. 🙏
Vorab noch ein paar Begriffsdefinitionen,
🧵‼️ (1/50)
Ich bin gespannt und hoffe 7 Tage reichen für eine Stichprobe und Feedback eurerseits. 🙏
Vorab noch ein paar Begriffsdefinitionen,
🧵‼️ (1/50)
https://twitter.com/xn__2k_dcc/status/1966989037904032004
weil #ChatGPT die Begrifflichkeiten schon kennt und so abkürzt:
WT = gewichteten Arbeits-Tokens/Weighted Time Token (Zahlungsmittel in der Zeit- und Gemeinwohlökonomie) - staatlich akzeptiert (Steuern/Abgaben), nicht spekulativ, zinsfrei, personenbezogen. (2/50)
WT = gewichteten Arbeits-Tokens/Weighted Time Token (Zahlungsmittel in der Zeit- und Gemeinwohlökonomie) - staatlich akzeptiert (Steuern/Abgaben), nicht spekulativ, zinsfrei, personenbezogen. (2/50)
TD = Teilhabedividende (Möglichkeit der unbedingten Existenz jedes Menschen) + Mindestversorgung (Wohnen/Grundenergie/ÖPNV/Bildung/Gesundheit)
Faktoren = gewichten die Token je nach Bedarf in einem vordefinierten Rahmen (wird später genauer erklärt)
Dann mal viel Spaß! (3/50)
Faktoren = gewichten die Token je nach Bedarf in einem vordefinierten Rahmen (wird später genauer erklärt)
Dann mal viel Spaß! (3/50)
Es wird 11 Kapitel umfassen und trägt den Titel:
#BeyondKapitalismus – Umsetzung in Etappen
Kapitel 1 – Ausgangslage und Leitplanken
Die Reform startet nicht mit einem Bruch, sondern mit einer Parallelordnung: (4/50)
#BeyondKapitalismus – Umsetzung in Etappen
Kapitel 1 – Ausgangslage und Leitplanken
Die Reform startet nicht mit einem Bruch, sondern mit einer Parallelordnung: (4/50)
Zum Euro tritt eine Zeit- und Gemeinwohlökonomie (WT) hinzu, die reale, zertifizierte Arbeitsstunden in gesellschaftlich prioritären Tätigkeiten vergütet. Maßstab ist die Lebenszeitgleichheit (1 Stunde = 1 Basiseinheit), (5/50)
differenziert über sachlich begründete Faktoren für Belastung, Gefahr, Knappheit, Qualifikation und Gemeinwohl. Der Staat akzeptiert WT für Steuern, (6/50)
Abgaben und Gebühren und garantiert damit einen Mindestwert; ein enges Kursband stabilisiert freiwillige Euro-Konvertierungen. Eine Teilhabedividende (TD) aus Bargeld und WT sowie in-kind-Leistungen stellt die unbedingte Existenz sicher. Bildung wird gebührenfrei, (7/50)
Praxis- und Sozialdienste werden in WT vergütet. Die Ordnung ist regelgebunden:
Ein unabhängiger Rat für Arbeitsbewertung (RAB) setzt Faktorbandbreiten evidenzbasiert, die Clearing- und Emissionsstelle (CES) sorgt für Ident-, Zeit- und Kursstabilität, (8/50)
Ein unabhängiger Rat für Arbeitsbewertung (RAB) setzt Faktorbandbreiten evidenzbasiert, die Clearing- und Emissionsstelle (CES) sorgt für Ident-, Zeit- und Kursstabilität, (8/50)
Missbrauch wird durch offene Algorithmen, Audits und Sanktionen eingedämmt.
Kapitel 2 – Monat 0 bis 6: Zünden ohne Systemschock
Im ersten Halbjahr schafft ein Gesetzespaket die Rechtsgrundlagen für WT, CES und RAB. Die TD startet in einer Light-Variante... (9/50)
Kapitel 2 – Monat 0 bis 6: Zünden ohne Systemschock
Im ersten Halbjahr schafft ein Gesetzespaket die Rechtsgrundlagen für WT, CES und RAB. Die TD startet in einer Light-Variante... (9/50)
(300 € + 20 WT), Bildungsgebühren entfallen. Drei Pilotregionen erproben die Kerntätigkeiten: Pflege, Kita/Schule, Müll/Abwasser und ÖPNV. Öffentliche Beschaffung akzeptiert initial 5 % WT. Für Beschäftigte bedeutet das: Parallel zum Eurolohn entsteht ein zusätzlicher, (10/50)
staatlich akzeptierter Wertstrom in WT, der vor allem dort ansetzt, wo Fachkräftelücken und hohe Belastungen herrschen. Für Arbeitgeber im Pilotkorridor: zertifizierte Zeiterfassung, transparente Faktorlogik, (11/50)
planbare Konvertibilität; für Kommunen: unmittelbare Entlastung bei Personalgewinnung in Diensten der Daseinsvorsorge. (12/50)
Kapitel 3 – Monat 6 bis 18: Skalierung I und Kursband
Nach erfolgreicher Pilotierung wird das WT-System auf alle sozialen Kernberufe ausgedehnt (rund 25–30 Berufsgruppen). Das Kursband (z.B. 14-16€/WT)
(13/50)
Nach erfolgreicher Pilotierung wird das WT-System auf alle sozialen Kernberufe ausgedehnt (rund 25–30 Berufsgruppen). Das Kursband (z.B. 14-16€/WT)
(13/50)
wird aktiviert; die CES interveniert automatisch: Weicht der Marktpreis nach oben, verkauft sie EUR-Gutscheine gegen WT; fällt er unter das Band, kauft sie WT zurück. (14/50)
Euro-Konvertierungen bleiben freiwillig und steuerpflichtig; reine WT-Vergütung gilt als Zeitvergütung. Ein Qualifikations-Booster erhöht temporär den Qualifikationsfaktor nach bestandenen Stufen; Anerkennungen ausländischer Abschlüsse werden beschleunigt. (15/50)
Arbeitsökonomisch zeigt sich bereits Verlagerungseffekt: Vakanzen in Pflege und Erziehung sinken messbar, Fluktuation geht zurück, Ausbildungsanmeldungen steigen. Ein Beispiel illustriert die Logik: Eine Pflegefachkraft mit Faktoren 1,20 × 1,25 × 1,10 × 1,10 × 1,20
(16/50)
(16/50)
erzielt rund 2,18 WT/h. Bei ca. 165 Monatsstunden entstehen ~360 WT, die anteilig zur Begleichung kommunaler Gebühren und Steuern eingesetzt werden können; der Eurolohn bleibt erhalten. Die TD – zusätzlich und nicht angerechnet – erzeugt einen echten Aufwärtsanreiz. (17/50)
Kapitel 4 – Monat 18 bis 36: Skalierung II und fiskalische Einbettung
Die zweite Skalierungswelle bindet Sekundärsektoren an: Sozialarbeit, Justiznahes, öffentlicher Bau/Erhalt, Reha/Therapie, Umwelt-Monitoring, offene Forschung. (18/50)
Die zweite Skalierungswelle bindet Sekundärsektoren an: Sozialarbeit, Justiznahes, öffentlicher Bau/Erhalt, Reha/Therapie, Umwelt-Monitoring, offene Forschung. (18/50)
Kommunen führen eine Bodenwert-Komponente ein; die Gesetzgebung gegen Steuervermeidung (Holding-/Stiftungs-Hybride, Angleichung von Kapitalerträgen) greift. WT-Akzeptanz bei Steuern wird schrittweise auf bis zu 20 % gedeckelt. (19/50)
Die öffentliche Beschaffung erhöht den WT-Anteil, ohne Euro-Budgets zu verdrängen – die Dualität stabilisiert.
Der RAB kalibriert Faktoren vierteljährlich. Wo sich Übersteuerung zeigt (WT-Maximierung durch Mikrozuschnitt von Tätigkeiten), (20/50)
Der RAB kalibriert Faktoren vierteljährlich. Wo sich Übersteuerung zeigt (WT-Maximierung durch Mikrozuschnitt von Tätigkeiten), (20/50)
greifen Berufsmix-Pflichten und Audit-Trails. Der Gesamtdeckel für Faktoren (z.B. Start nahe 2,5 WT/h) kann, wenn der Arbeitsmarkt sich entspannt, leicht abgesenkt werden (etwa Richtung 2,2), um Spreizungen zu begrenzen, (21/50)
ohne die Attraktivität sozialer Berufe zu gefährden.
Kapitel 5 – Jahr 3 bis 5: Integration und europäische Anschlussfähigkeit
Mit stabilen Kennzahlen (sinkende Vakanzquoten, verlässlicher Kurs im Band, (22/50)
Kapitel 5 – Jahr 3 bis 5: Integration und europäische Anschlussfähigkeit
Mit stabilen Kennzahlen (sinkende Vakanzquoten, verlässlicher Kurs im Band, (22/50)
unveränderte oder gedämpfte EUR-Inflation) beginnt die juristische und technische EU-Anpassung: Interoperable WT-Standards als offenes Protokoll, Sozialversicherungsrecht und Steuerrecht werden auf Kompatibilität gebracht. (23/50)
Grenzgänger-Modelle und Kommunalverbünde erproben die gegenseitige Anerkennung zertifizierter Stunden. Gleichzeitig verstetigen sich die neuen Einnahmequellen: progressiver Erbanfall (empfängerbezogen), Leerstandsabgaben und Luxus-CO₂-Lenkung finanzieren TD, (24/50)
CES-Operationen und Bildungsaufwuchs.
In dieser Phase werden die Outcome-Metriken sichtbar: Wartelisten in Pflege und Therapie schrumpfen, Pünktlichkeit im ÖPNV steigt, Recycling- und Sanierungsquoten verbessern sich. (25/50)
In dieser Phase werden die Outcome-Metriken sichtbar: Wartelisten in Pflege und Therapie schrumpfen, Pünktlichkeit im ÖPNV steigt, Recycling- und Sanierungsquoten verbessern sich. (25/50)
Der Gini-Koeffizient (Einkommen/Vermögen) bewegt sich nach unten, die Armutsquote sinkt deutlich – nicht durch Verdrängung, sondern durch zusätzliche, WT-gestützte Erwerbspfade. (26/50)
Kapitel 6 – Jahr 5 bis 10: Reifephase der Dualökonomie
Das System erreicht Betriebsruhe: Die Doppelwährung ist erwartbar, Missbrauchsrisiken sind durch offene Algorithmen, Stichproben-Audits, Rotationen im RAB und harte Sanktionen kontrolliert. (27/50)
Das System erreicht Betriebsruhe: Die Doppelwährung ist erwartbar, Missbrauchsrisiken sind durch offene Algorithmen, Stichproben-Audits, Rotationen im RAB und harte Sanktionen kontrolliert. (27/50)
Bildungsfreiheit ist etabliert, Praxisphasen werden zuverlässig in WT vergütet; die Qualifikationspipeline füllt Engpassberufe dauerhaft.
Makroökonomisch zeigt sich eine robustere Arbeitsangebotskurve in gesellschaftlich kritischen Tätigkeiten, (28/50)
Makroökonomisch zeigt sich eine robustere Arbeitsangebotskurve in gesellschaftlich kritischen Tätigkeiten, (28/50)
ohne dass der Euro-Arbeitsmarkt austrocknet. Unternehmen lernen, WT-Anteile in Angeboten zu bepreisen; Kommunen bilanzieren WT-Einnahmen gegen Gebührenforderungen. Auf Haushaltsebene wird die TD zur planbaren Basis, (29/50)
die – kombiniert mit planbaren WT-Einsätzen – Einkommensschwankungen abfedert. Klimapolitisch beschleunigt die Verfügbarkeit von WT-vergüteten Tätigkeiten (PV-Montage, Gebäudesanierung, kommunale IT-Sicherheit) die Umsetzung lokaler Transformation, (30/50)
weil Fachkräfte verfügbar und finanzielle Hürden gesenkt sind.
Kapitel 7 – Jahr 10 bis 20: Tiefenumbau und Normalisierung
In der Langfristphase wird die WT-Logik selektiv in weitere, (31/50)
Kapitel 7 – Jahr 10 bis 20: Tiefenumbau und Normalisierung
In der Langfristphase wird die WT-Logik selektiv in weitere, (31/50)
nachweislich gemeinwohlrelevante Tätigkeiten ausgedehnt oder – wo Automatisierung Engpässe löst – wieder zurückgefahren. Der RAB arbeitet mit lernenden, öffentlichen Modellen für Knappheit und Outcome; Faktoren bleiben gedeckelt und werden dynamisch angepasst. (32/50)
Die TD kann – je nach fiskalischer Lage und Produktivitätsfortschritt – moderat steigen oder zweckgebundenen Komponenten (z.B. Bildungs-/Pflegegutscheine) weichen.
Gesamtgesellschaftlich normalisiert sich der Gedanke, dass Zeitvergütung und Eurolohn koexistieren. (33/50)
Gesamtgesellschaftlich normalisiert sich der Gedanke, dass Zeitvergütung und Eurolohn koexistieren. (33/50)
Luxus- und Rentier-Einkünfte erhalten systematisch keinen Faktoraufschlag; Vermögenskonzentration wird über Erbanfall- und Bodenregime gedämpft. Die Fachkräftelücke in Daseinsvorsorge-Sektoren bleibt unter einer politisch gesetzten Schwelle (z.B. < 3 %), (34/50)
Fluktuation in Pflege und Erziehung ist nachhaltig reduziert, die Armutsquote gegenüber dem Ausgangsniveau halbiert. (35/50)
Kapitel 8 – Governance im Vollbetrieb
Die Legitimation des Systems ruht auf Transparenz und Rechenschaft: Der RAB publiziert nachvollziehbare Berichte zu Faktoren, Datenquellen und Unsicherheiten; Minderheitenvoten sind vorgesehen. (36/50)
Die Legitimation des Systems ruht auf Transparenz und Rechenschaft: Der RAB publiziert nachvollziehbare Berichte zu Faktoren, Datenquellen und Unsicherheiten; Minderheitenvoten sind vorgesehen. (36/50)
Die CES veröffentlicht monatliche Kurs- und Interventionsprotokolle. Öffentliche Dashboards stellen Personal-, Outcome-, Verteilungs- und monetäre KPIs bereit, personenbezogene Daten bleiben strikt privat. Rotationen, (37/50)
Inkompatibilitäten und Cooling-off-Perioden sichern Unabhängigkeit; Blacklists und spürbare Sanktionen begrenzen Trittbrettfahrerei. Der Rechtsrahmen sichert, dass WT nicht zu Finanzspekulation wird: personenbezogen, zinsfrei, (38/50)
nicht beleihbar; 10 % Vesting bis Jahresende dämpfen kurzfristige Druckeffekte, Einlöseobergrenzen verhindern Aufkäufe.
Kapitel 9 – Fiskalische Einordnung und Stabilisierung
WT schaffen durch Staatsakzeptanz Wert ohne Euro-Primärausgabe. (39/50)
Kapitel 9 – Fiskalische Einordnung und Stabilisierung
WT schaffen durch Staatsakzeptanz Wert ohne Euro-Primärausgabe. (39/50)
Die fiskalische Tragfähigkeit kommt aus drei Quellen: Umschichtung (Subventionsabbau, insbesondere klimaschädliche), Schließen von Steuerlücken und neuen Lenkungsabgaben, plus der Tatsache, (40/50)
dass WT-Einsatz an Stelle von Euro-Zahlungen bei Steuern/Gebühren die Euro-Kassen nicht unterläuft, sondern – über das Kursband und die begrenzte Akzeptanzquote – kalkulierbar macht. Inflationsrisiken werden über das Kursband, (41/50)
die Faktor-Caps und die schrittweise Sektorlogik begrenzt. Wo Überhitzungsanzeichen auftreten, kann der RAB Faktoren temporär absenken oder die CES das Band defensiver setzen. (42/50)
Kapitel 10 – Risiken und Korrekturmechanismen
Drei Risiken sind zentral:
Erstens Verdrängung im Euro-Sektor. Antwort: harte Deckel, Berufsmix-Pflicht, enges Band, graduelle Sektorausdehnung.
Zweitens: Verwaltungsüberlastung. Antwort: minimalinvasive, (43/50)
Drei Risiken sind zentral:
Erstens Verdrängung im Euro-Sektor. Antwort: harte Deckel, Berufsmix-Pflicht, enges Band, graduelle Sektorausdehnung.
Zweitens: Verwaltungsüberlastung. Antwort: minimalinvasive, (43/50)
offene digitale Zeiterfassung (App + Terminal), standardisierte Audits, stufenweiser Roll-out.
Drittens: politische Vereinnahmung. Antwort: institutionelle Unabhängigkeit (RAB/CES), öffentliche Protokolle, Rotationen und klare Konfliktregeln. (44/50)
Drittens: politische Vereinnahmung. Antwort: institutionelle Unabhängigkeit (RAB/CES), öffentliche Protokolle, Rotationen und klare Konfliktregeln. (44/50)
Kapitel 11 – Was sich spürbar verändert
Für Bürgerinnen und Bürger entsteht eine planbare Basissicherung (TD), die nicht gegen Erwerb angerechnet wird, und ein zusätzlicher, gesellschaftlich honorierter Vergütungspfad in WT. (46/50)
Für Bürgerinnen und Bürger entsteht eine planbare Basissicherung (TD), die nicht gegen Erwerb angerechnet wird, und ein zusätzlicher, gesellschaftlich honorierter Vergütungspfad in WT. (46/50)
Für Fachkräfte in belasteten Berufen steigt die Netto-Attraktivität sofort, ohne dass andere Sektoren leergefegt werden. Für Kommunen sinken Personalengpässe in kritischen Diensten, Investitionen in Klima- und Resilienzprojekte beschleunigen. (47/50)
Für den Staat verbessert sich die Verteilungsbilanz: Vermögens- und Einkommensspreizung werden gedämpft, Teilhabe wächst, die Leistungsfähigkeit der Grundversorgung steigt – ohne Schock für die Euro-Ökonomie. (48/50)
Zeithorizont in einem Satz:
0–6 Monate Rechtsrahmen und Piloten, 6–18 Monate Skalierung auf Kernberufe mit Kursband, 18–36 Monate Ausweitung und fiskalische Einbettung, Jahr 3–5 europäische Integration und Verstetigung, Jahr 5–10 Reifephase mit stabilen KPIs, (49/50)
0–6 Monate Rechtsrahmen und Piloten, 6–18 Monate Skalierung auf Kernberufe mit Kursband, 18–36 Monate Ausweitung und fiskalische Einbettung, Jahr 3–5 europäische Integration und Verstetigung, Jahr 5–10 Reifephase mit stabilen KPIs, (49/50)
Jahr 10–20 Tiefenumbau und Normalisierung der Dualökonomie. (50/50)
War echt viel Text, ich weiß. Es steht alles zur Diskussion. Es ist noch lange nicht fertig. Ein Anfang.
Und jetzt möchte ich nochmal DANACH von euch wissen: Halter ihr es jetzt für möglich?👇
War echt viel Text, ich weiß. Es steht alles zur Diskussion. Es ist noch lange nicht fertig. Ein Anfang.
Und jetzt möchte ich nochmal DANACH von euch wissen: Halter ihr es jetzt für möglich?👇
@threadreaderapp unroll please
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh