
Womöglich der Mensch auf dem Planeten, der am meisten über wirecard weiß (Tagesschau)
https://t.co/hsfJY7szyy @askjig #afdverbotsverfahrenjetzt
2 subscribers
How to get URL link on X (Twitter) App

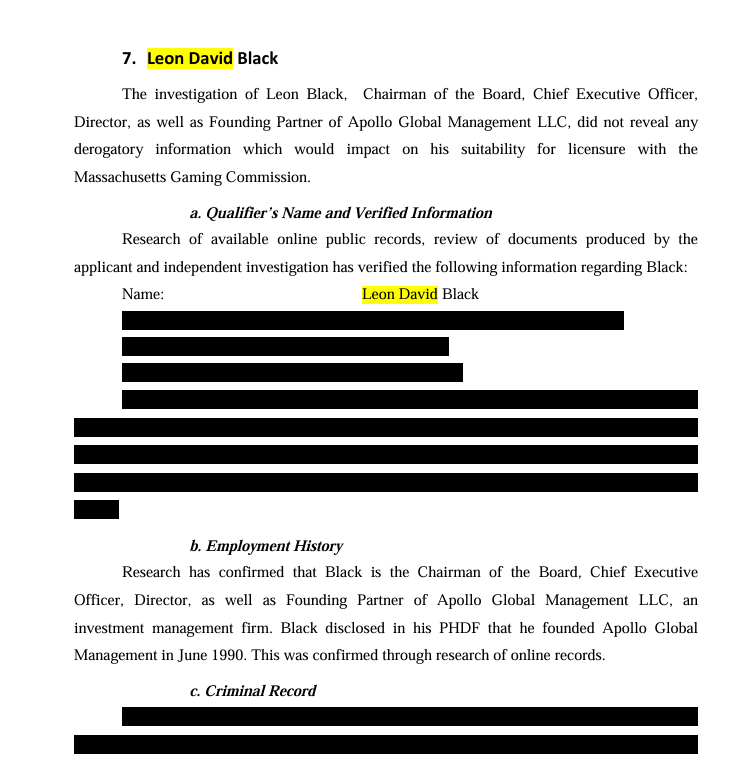
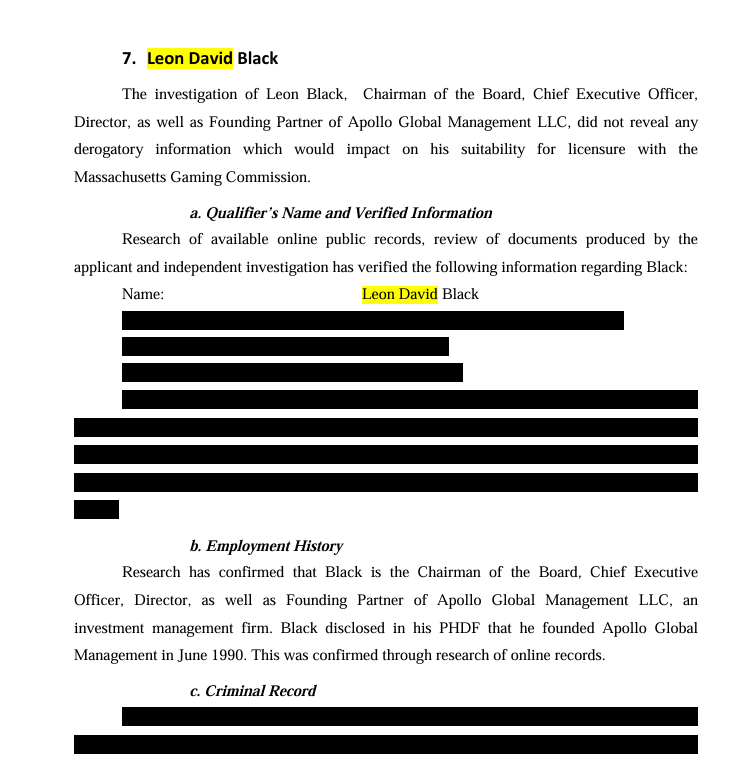 #leondavidblack #Apollo #caesars
#leondavidblack #Apollo #caesars 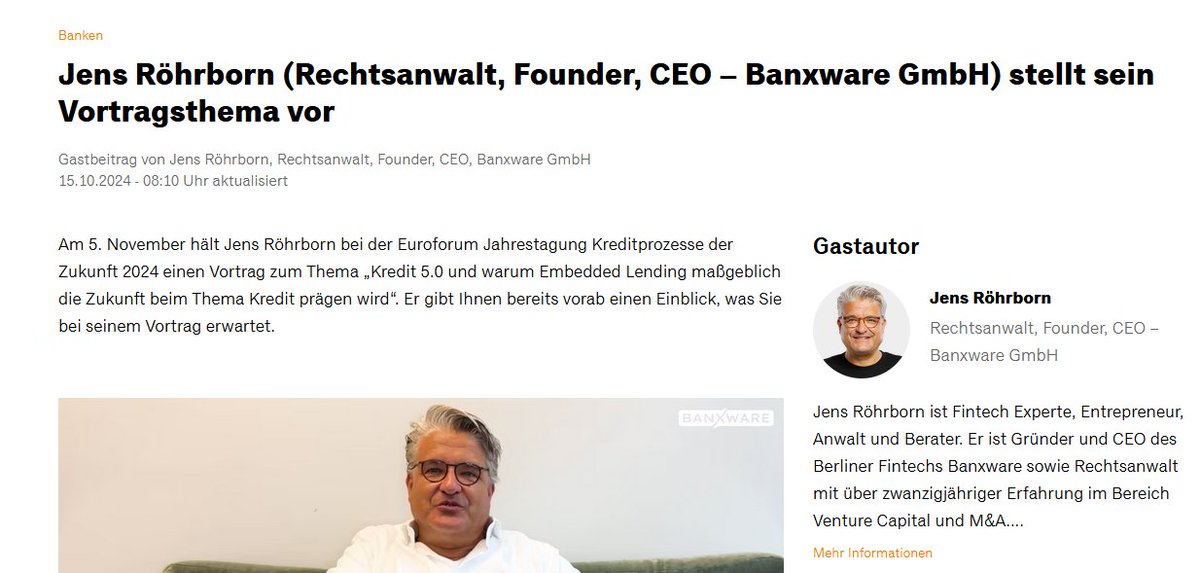
https://twitter.com/chickajig/status/2023038213338837059
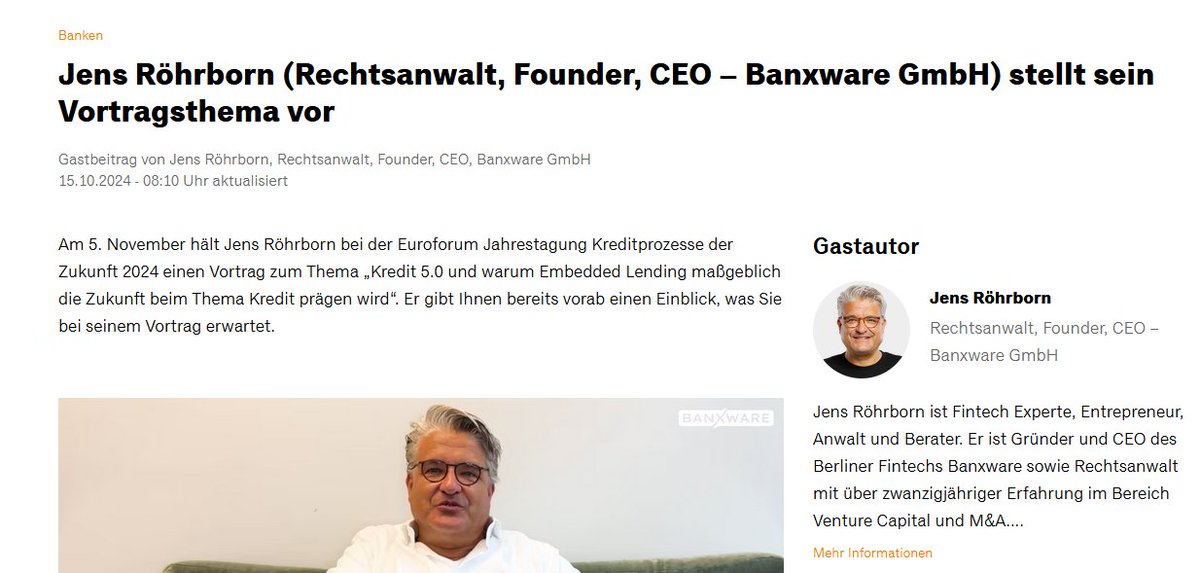 #wirecard
#wirecard 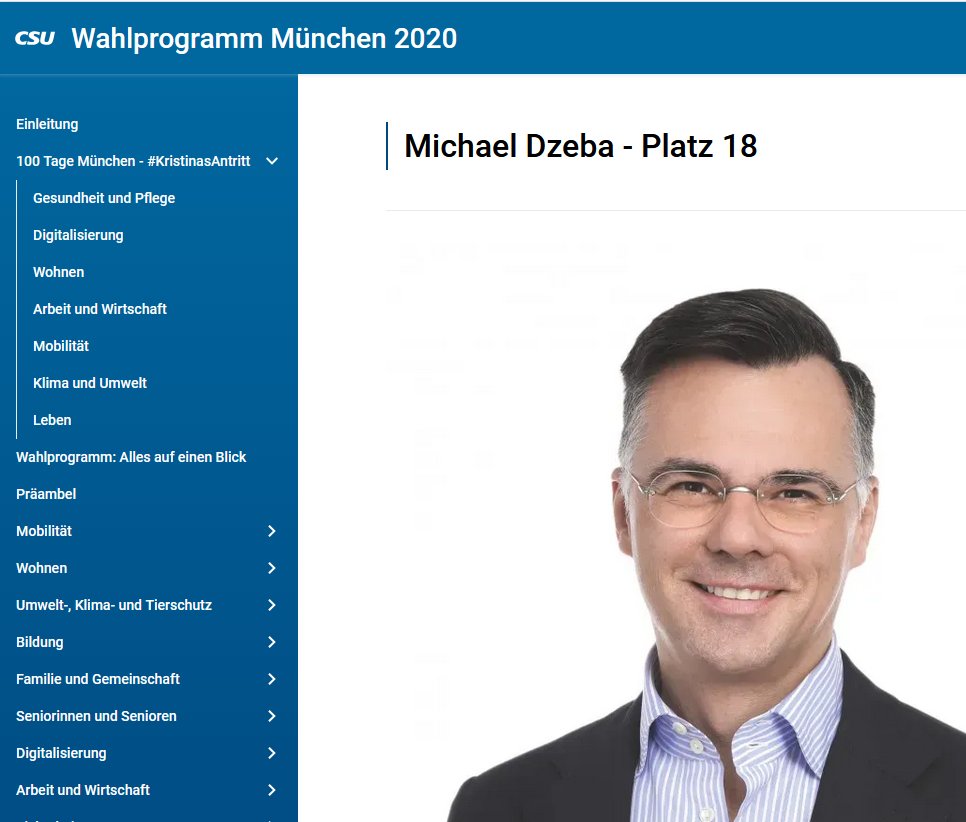

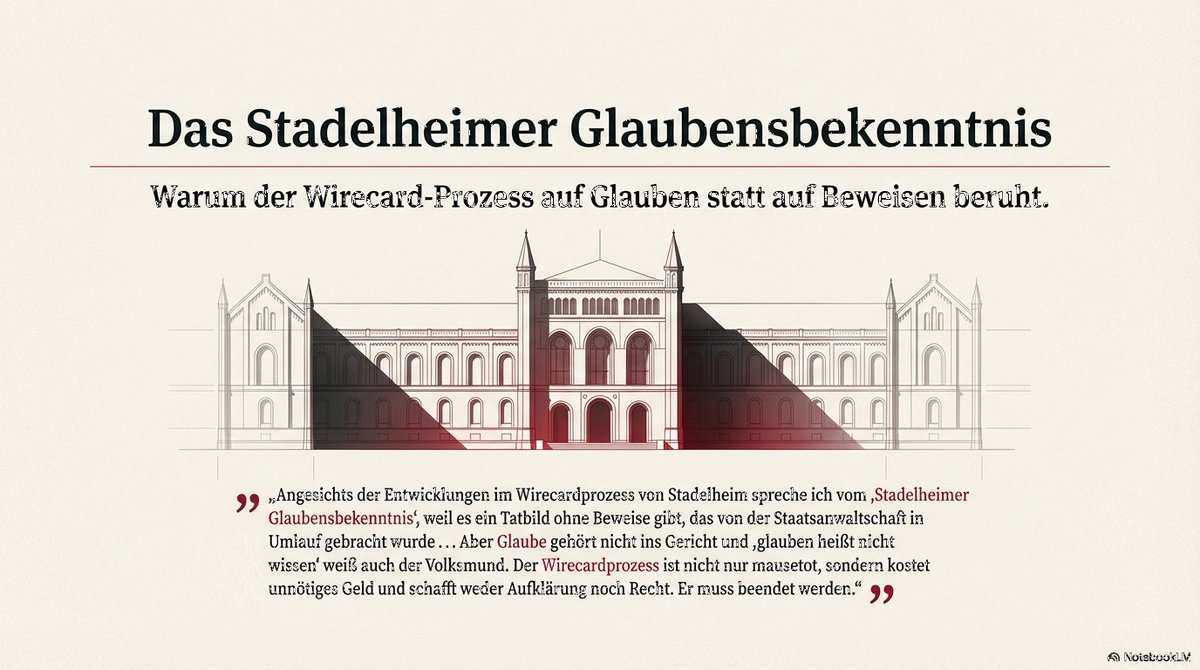
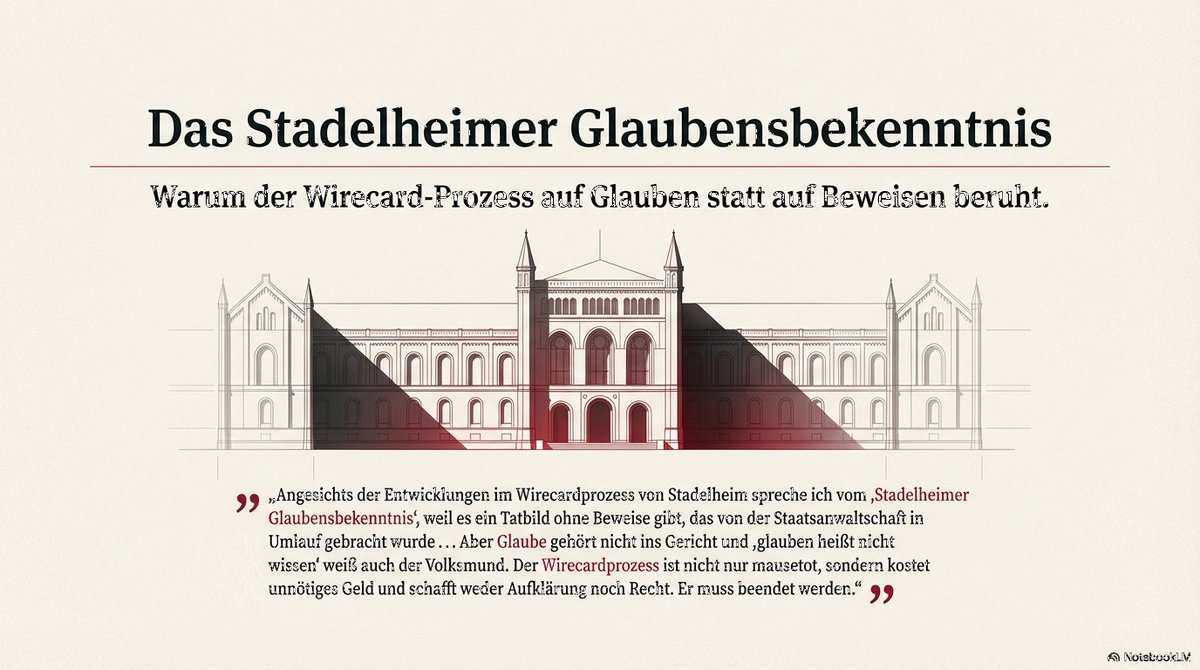 #wirecard #enjoythesilence
#wirecard #enjoythesilence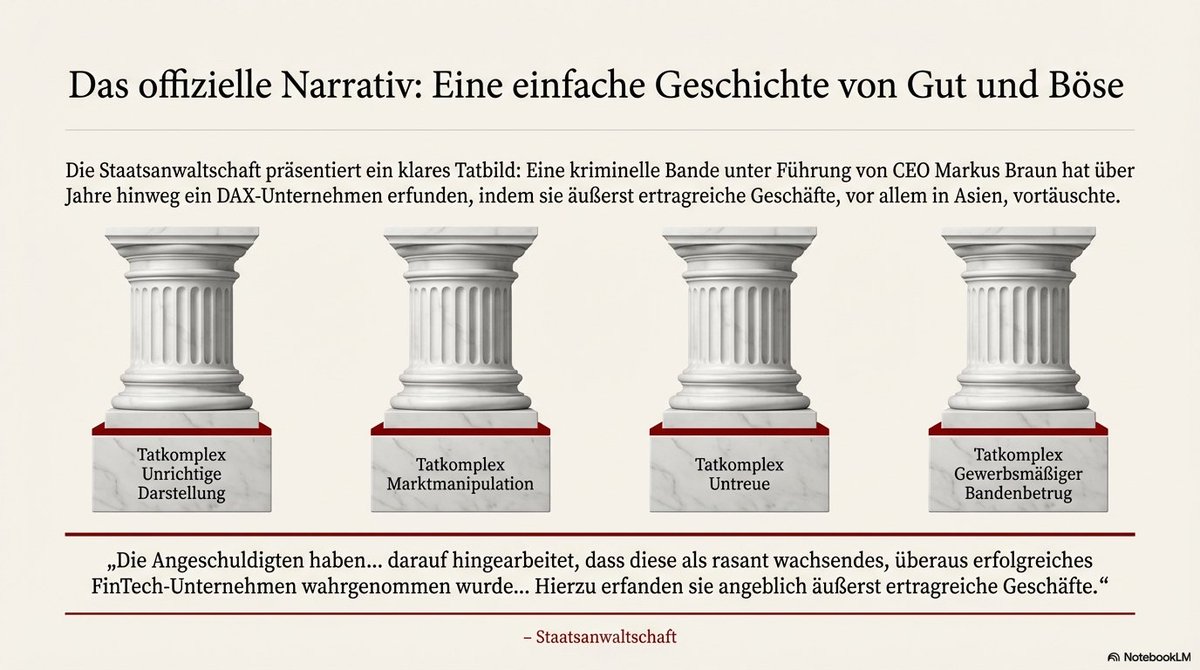

 #wirecard #schandelsblättchen #enjoythesilence #silencespeaks #medienskandl
#wirecard #schandelsblättchen #enjoythesilence #silencespeaks #medienskandl


 #wirecard
#wirecard 
 #bretagne
#bretagne